Einhergehend mit der wachsenden Komplexität der Entwicklungen von Stadt, Land und Natur ist das Thema Baukultur für den urbanen Diskurs mittlerweile unverzichtbar. Für die regio.polis MÜNSTERLAND sprach unsere stellv. Chefredakteurin Marie Sammet mit Stefan Rethfeld, Leiter des Sachbereichs Vermittlung und Baukultur bei der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, denn auch im Münsterland spielt Baukultur eine tragende Rolle, wenn es um das Bewahren, Weiterentwickeln und die Neuinterpretation des bebauten und unbebauten Raumes geht. Im Gespräch erzählte Stefan Rethfeld u. a., was die Baukultur und -denkmäler der Region auszeichnet, wieso das Ziel kleinerer Orte eine Art „Ländliche Urbanität“ sein müsste und warum das Thema Baukultur sowohl für die heutige als auch für die zukünftige Gesellschaft eine der wichtigsten Aufgaben ist.
Diesen Artikel* weiterlesen im polisFORUM:Kostenlos registrieren →Zugang zu allen Beiträgen und unserem E-Paper. Teste unser digitales CONTENT-ABO kostenlos für 30 Tage1.Digitales
CONTENT-ABO →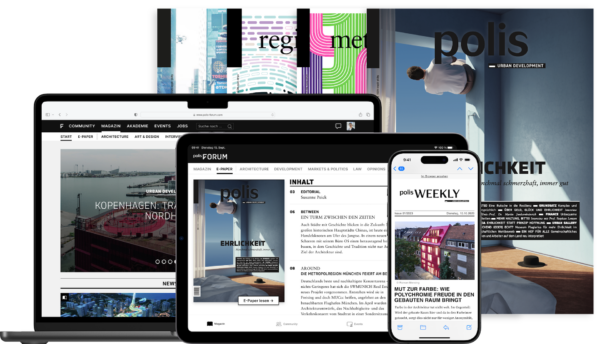
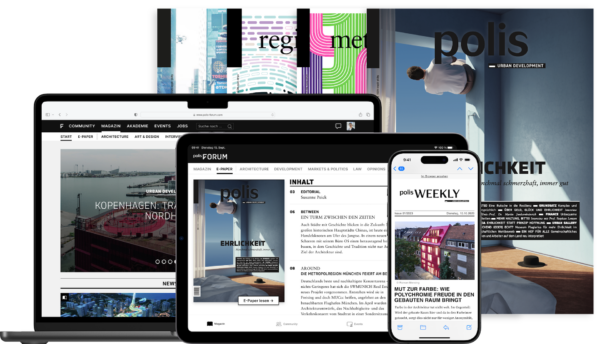 1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.
1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.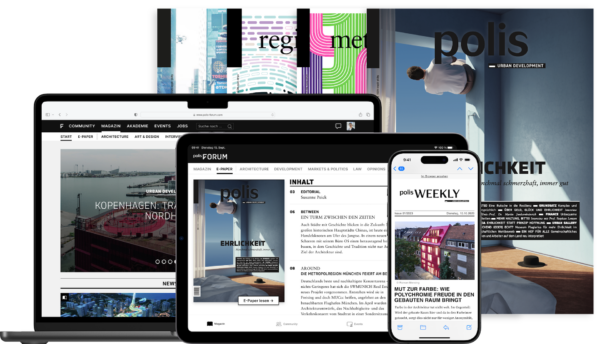 1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.
1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.