In unserer Ausgabe polis SEHNSÜCHTE sprachen wir mit Prof. Elisabeth Endres zum Thema Low-Tech-Bauen – per Videocall aus einem fahrenden Zug. Technik ermöglicht also ganz bemerkenswerte Dinge, die wir schnell als selbstverständlich in unser alltägliches Leben integriert haben. Auch im Bausektor legt man große Hoffnungen auf ihre beeindruckenden Versprechen: Emissionen sollen reduziert werden, smart buildings ganz von selbst funktionieren und ohne den „Störfaktor Mensch“, der doch zu gerne das Licht anlässt, oder bei laufender Heizung das Fenster öffnet. Endres ist eine der Stimmen, die gegen diese Auffassung und für ein umfassendes Neudenken im Bauen eintritt, um unsere Welt zukunftsfest zu machen. Einer der Faktoren dabei ist für sie das Bauen mit weniger Technik und mehr Suffizienz.
Diesen Artikel* weiterlesen im polisFORUM:Kostenlos registrieren →Zugang zu allen Beiträgen und unserem E-Paper. Teste unser digitales CONTENT-ABO kostenlos für 30 Tage1.Digitales
CONTENT-ABO →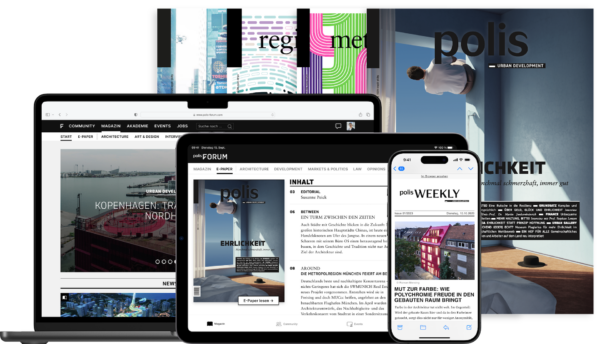
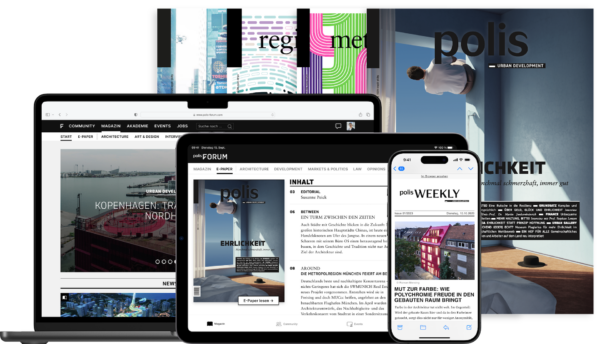 1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.
1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.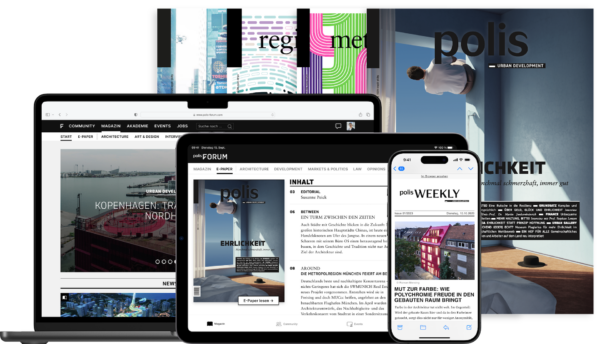 1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.
1 Kostenlos für 30 Tage, danach 12,99 € im Monat. Jederzeit kündbar.